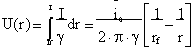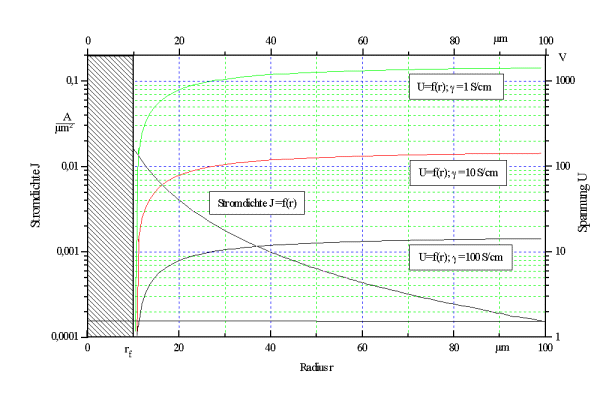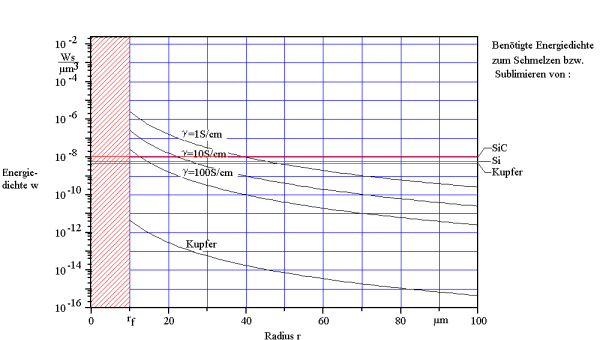|
Timm, Mathias Elektronische Stromquellen für das funkenerosive Schneiden von elektrisch schlecht leitfähigen Werkstoffen
Für den breiten industriellen Einsatz von Keramikbauteilen ist eine gute Bearbeitbarkeit des Keramikwerkstoffes im gesinterten Zustand erforderlich. Der Formgebung von Keramikbauteilen ist vor dem Sinterprozeß kaum eine Grenze gesetzt. Die Anforderungen an die Oberflächenqualität und die Maßgenauigkeit erfordern jedoch oft, das Werkstück nach dem Sinterprozeß zu bearbeiten bzw. nachzubearbeiten. Die funkenerosive Bearbeitung von Keramiken hat gegenüber anderen Bearbeitungsverfahren die geringsten Einschränkungen in der Formgebung. Auch in der Bearbeitungsgenauigkeit läßt es kaum Wünsche offen. Bisherige Untersuchungen zur funkenerosiven Bearbeitbarkeit von Keramiken wurden auf industriellen Anlagen durchgeführt, die für die funkenerosive Metallerosion entwickelt wurden. Es ist festzustellen, daß trotz gleicher technologischer Einstellparameter an den Erodieranlagen die Erodierbarkeit von Keramiken nicht auf allen Anlagen gegeben ist bzw. daß die Bearbeitungsergebnisse stark voneinander abweichen. Um die Effektivität der funkenerosiven Keramikbearbeitung zu erhöhen, ist es notwendig, die werkstoffspezifischen Einflüsse der Keramik auf den Erosionsprozeß zu untersuchen und eine angepaßte elektronische Stromquelle zu entwickeln. Theoretische Vorüberlegungen Den größten Einfluß auf den Erodierprozeß hat die niedrigere spezifische elektrische Leitfähigkeit der Keramiken. Diese niedrigere spezifische elektrische Leitfähigkeit führt zu einem zusätzlichen Spannungsabfall über dem Werkstück. Die Höhe des Spannungsabfalles ist neben der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit des Werkstoffes vom Funkenfußpunktradius am Werkstück abhängig. Der Spannungsabfall läßt sich in guter Näherung berechnen, indem der Funkenfußpunkt als Halbkugel in einem halbunendlichen Körper betrachtet wird. Wird ein Funkenfußpunktradius von rf = 10 µm und ein konstanter Entladestrom von ie = 10 A angenommen, so ergeben sich die in Bild 1 dargestellten Stromdichte- und Spannungsverläufe in Abhängigkeit vom Abstand zum Funkenfußpunkt. Da nur die Leitungsvorgänge in dem Werkstück betrachtet werden sollen, wurde das Potential der Halbkugel mit j = 0 festgelegt. Der Spannungsabfall läßt sich dann nach Gl. 1 und die Stromdichte nach Gl. 2 berechnen.
Diese Berechnungen zeigen, welche Leerlaufspannungen erforderlich sind, um eine Keramik unter den genannten Bedingungen funkenerosiv zu bearbeiten. Da in unmittelbarer Umgebung des Funkenfußpunktes der entscheidende Anteil der Spannung zwischen den Generatoranschlußklemmen abfällt, ist die Geometrie des Werkstückes zwischen dem Arbeitsspalt und der Kontaktierungsstelle von untergeordneter Bedeutung.
Desweiteren wird bei der Berechnung vorausgesetzt, daß die Materialeigenschaften sich durch die Energieeinwirkung nicht verändern. Bei der Berechnung wurde ein Strom von ie = 10 A und eine Entladedauer von te = 1 µs bei einem Funkenfußpunktradius von rf = 10 µm angenommen. In Bild 2 sind die Energiedichteverteilungen bei verschiedenen spezifischen elektrischen Leitfähigkeiten dargestellt. Zum Vergleich wurde der Energiedichteverlauf für Kupfer mit g = 5.6 105 S/cm berechnet und dargestellt. Um die Wirkungen der Joul'schen Wärme auf das Werkstück zu beurteilen, ist die benötigte Energiedichte zum Aufschmelzen von Kupfer und Silizium angegeben. Werkstoffe aus Siliziumkarbid (SiC) können in ihrer Struktur sehr unterschiedlich auftreten. SiC hat keinen Schmelzpunkt, sondern dissoziiert ab ca. T = 2600 K in Cfest + Sigasförmig. Für SiC wurde die Energiedichte dargestellt, die benötigt wird, um den Werkstoff von T = 20°C auf Ts = 2600°C zu erwärmen. Die Wärmeleitung konnte wegen der kurzen Zeitdauer von te = 1 µs vernachlässigt werden.
Im Bild 2 ist ersichtlich, daß unter den angenommenen Bedingungen die Joul'sche Wärme bei Kupfermaterialien ohne zusätzliche Energie aus dem Funken nicht zum Schmelzen des Materials führt. Dies bestätigt die Abtragstheorie der funkenerosiven Metallbearbeitung. Bei spezifischen elektrischen Leitfähigkeiten wie sie bei SiSiC und SiC vorliegen, kommt es im Gegensatz zu metallischen Werkstoffen allein durch die Joul'sche Wärme zum Schmelzen bzw. zum Sublimieren des Materials. Es kann daher davon ausgegangen werden, daß die Joul'sche Wärme für die funkenerosive Bearbeitung von Keramiken im angegebenen Leitfähigkeitsbereich einen bedeutenden Einfluß auf den Abtragsmechanismus hat.
Die Abnahme der Klemmenspannung bei konstantem Entladestrom resultiert vorwiegend aus dem sich mit der Entladedauer vergrößernden Funkenfußpunktradius rf. Eine Erhöhung des Entladestromes führt erwartungsgemäß bei gleichbleibendem Werkstückwiderstand zu einer Erhöhung der Klemmenspannung. Nach dem Abschalten der Leistungsstufe ist bei gleichem Zündstrom ein Ansteigen der Klemmenspannung zu beobachten, was sich aus der energetisch bedingten Verengung des Funkenkanals und einer Verkleinerung des Funkenfußpunktes ergibt.
Da die Messung der Zündverzögerungszeit online erfolgt, ist eine Echtzeitsteuerung jedes Erodierimpulses möglich. |